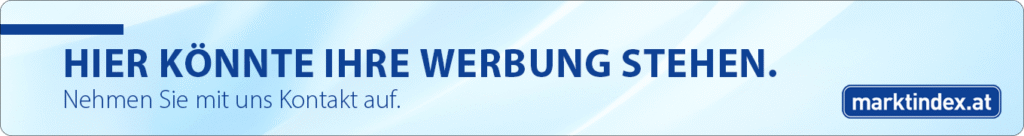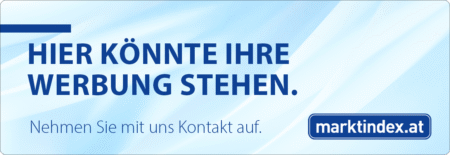Es beginnt oft schleichend: Ein Gefühl von bleierner Müdigkeit, das sich nicht durch Schlaf vertreiben lässt. Morgens kommen Sie kaum aus dem Bett, am Nachmittag kämpfen Sie gegen ein unsichtbares Energieloch und abends fehlt jede Kraft für soziale Aktivitäten. Wenn Ärztinnen und Ärzte dann Blut abnehmen, folgt nicht selten die große Ratlosigkeit: Die Werte sind alle im Normbereich. Kein Eisenmangel, keine Schilddrüsenunterfunktion, keine auffälligen Entzündungswerte. Und trotzdem ist da diese lähmende Erschöpfung. Wie kann das sein?
Die Antwort: Müdigkeit kann viele Gesichter haben. Und nicht alle zeigen sich im Labor.
Wenn die Mitochondrien streiken
Ein Bereich, dem in der klassischen Medizin bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist die Energiegewinnung in unseren Körperzellen. In jeder Zelle sitzen Mitochondrien, winzige Organellen, die wie „Kraftwerke“ funktionieren. Sie wandeln Nährstoffe in Energie um. Doch diese Mitochondrien können unter bestimmten Bedingungen in ihrer Funktion gestört sein, dazu zählen oxidativer Stress, Schadstoffe, Umweltbelastungen oder langanhaltende Entzündungsprozesse im Körper, die nicht akut, aber chronisch verlaufen.
Eine gestörte Mitochondrienfunktion kann dazu führen, dass selbst bei normaler Ernährung und guten Blutwerten schlichtweg zu wenig Energie für den Alltag bereitgestellt wird. Was sich bemerkbar machen kann als diffuse Müdigkeit, geistige Erschöpfung oder auch Muskelschwäche. Die Forschung auf diesem Gebiet steckt zwar noch in den Kinderschuhen, liefert aber erste Hinweise darauf, dass chronische Müdigkeit durchaus ein zelluläres Problem sein kann. Bisher hatte man vor allem Hormonhaushalt oder Stoffwechsel Aufmerksamkeit geschenkt.
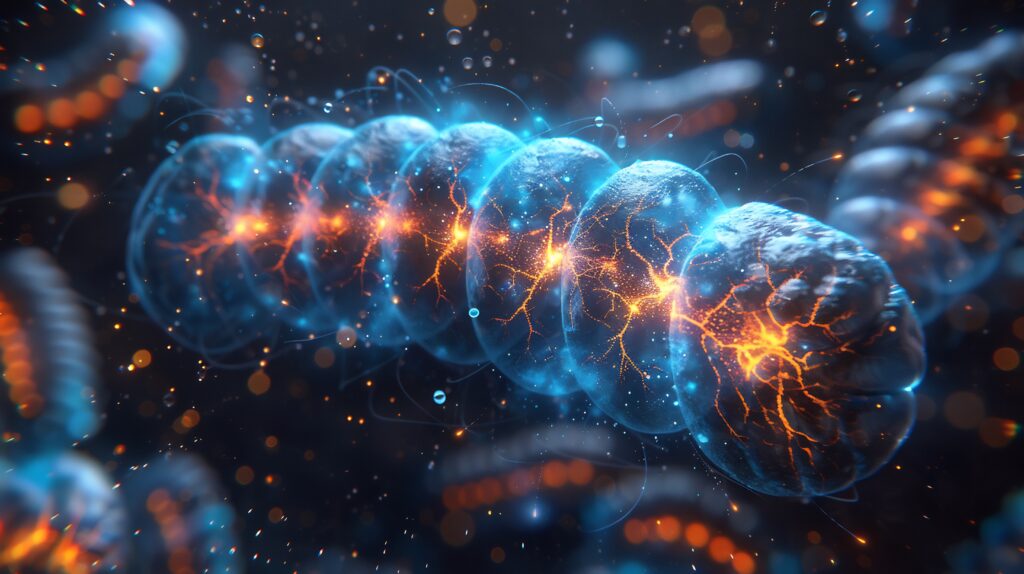
Dysbalance im Nervensystem: Wenn der Körper ständig „Alarm“ schlägt
Ein weiterer, oft übersehener Faktor ist das vegetative Nervensystem, genauer gesagt: das Verhältnis von Sympathikus und Parasympathikus. Diese beiden Gegenspieler steuern unseren Aktivitäts- und Erholungsmodus. Unter Dauerstress, sei er emotional, beruflich oder unterschwellig, kann es passieren, dass der Körper quasi im „Notfallmodus“ funktioniert. Der Parasympathikus, also der Verantwortliche für Erholung und Regeneration, kommt kaum noch zum Zug. Interessanterweise lässt sich dieser Zustand nicht immer im Blutbild nachweisen. Cortisolwerte, die den Stressabbau anzeigen könnten, schwanken stark im Tagesverlauf und liefern nur eine Momentaufnahme. Dennoch kann genau dieser Zustand chronischer Überaktivierung der Grund für die Erschöpfung sein. Der Körper versucht, auf Reserve zu leben. Das kann Wochen, Monate und manchmal sogar Jahre andauern und beeinträchtigt die Lebensqualität enorm.

Der unterschätzte Einfluss des Mikrobioms
Dass unser Darm mehr ist als nur ein Verdauungsorgan, ist längst bekannt. Aber wie stark er mit unserer Energieversorgung verknüpft ist, wird erst langsam deutlich. Ein aus dem Gleichgewicht geratenes Mikrobiom – das ist die Gesamtheit der Darmbakterien – kann über verschiedene Wege zu ständiger Müdigkeit beitragen. Zum Beispiel, indem es stille Entzündungen im Körper fördert oder die Aufnahme bestimmter Nährstoffe behindert. Selbst wenn im Blutbild etwa Vitamin B12 oder Folsäure unauffällig erscheinen, kann die Bioverfügbarkeit im Gewebe gestört sein. Das heißt: Es gibt zwar keinen direkten Mangel, aber es kommt nicht genug dort an, wo es gebraucht wird. Besonders Menschen mit Vorerkrankungen wie Reizdarm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder einem hohen Stresslevel könnten hier empfindlich reagieren. Oft ist den betroffenen Personen dieser Zustand gar nicht bewusst.

Schlafstörung ohne es zu wissen?
Ein weiterer Aspekt, der häufig übersehen wird, sind Schlafstörungen, denen man sich selbst gar nicht bewusst ist. Viele Betroffene glauben, ausreichend zu schlafen: In Wirklichkeit schlafen viele Menschen nicht so tief, wie sie denken. Ihr Schlaf wird immer wieder durch kurze, unbemerkte Wachphasen, leichten Schlaf oder unruhige Träume gestört. Eine mögliche Ursache dafür ist das sogenannte UARS – ein wenig bekanntes Atemproblem in der Nacht. Dabei handelt es sich um eine milde Form der Schlafapnoe, die aber keine klassischen Atemaussetzer zeigt und deshalb in der Diagnostik oft unentdeckt bleibt. Menschen mit UARS schlafen häufig unruhig, wachen verspannt oder mit Herzklopfen auf und fühlen sich auch nach acht Stunden Schlaf wie „gerädert“. Ein einfacher Bluttest reicht hier nicht, oft braucht es eine gezielte Schlafanalyse, zum Beispiel im Schlaflabor.

Emotionale Erschöpfung, die sich körperlich zeigt
Nicht zuletzt kann sich auch psychischer Druck körperlich zeigen. Es gibt Erschöpfungszustände, bei denen keine Depression im klinischen Sinn vorliegt, aber dennoch eine tiefe emotionale Leere, Überforderung oder Sinnkrise spürbar ist. Dieses Phänomen ist vor allem bei Frauen zwischen 35 und 55 Jahren weit verbreitet – in einer Lebensphase, in der sie oft beruflich stark eingebunden, familiär gefordert und gesellschaftlich unter Druck stehen. Die Psyche meldet sich dabei nicht immer mit klassischer Traurigkeit, sondern mit Müdigkeit, Antriebslosigkeit, innerer Unruhe oder sogar körperlichen Schmerzen. Auch hier gilt: Die Standardwerte können völlig unauffällig sein und doch liegt die Ursache in einem Ungleichgewicht, das ernst genommen werden sollte.

Fazit: Wenn Sie sich seit Wochen oder Monaten müde fühlen, obwohl medizinisch alles in Ordnung scheint, dann bedeutet das nicht, dass Sie sich täuschen oder sich nur zusammenreißen müssten. Es bedeutet vielmehr, dass die Ursache Ihrer Erschöpfung sich nicht mit einfachen Parametern erfassen lässt. Und dass Ihr Körper – oder Ihre Psyche – möglicherweise auf subtiler Ebene aus dem Gleichgewicht geraten ist.